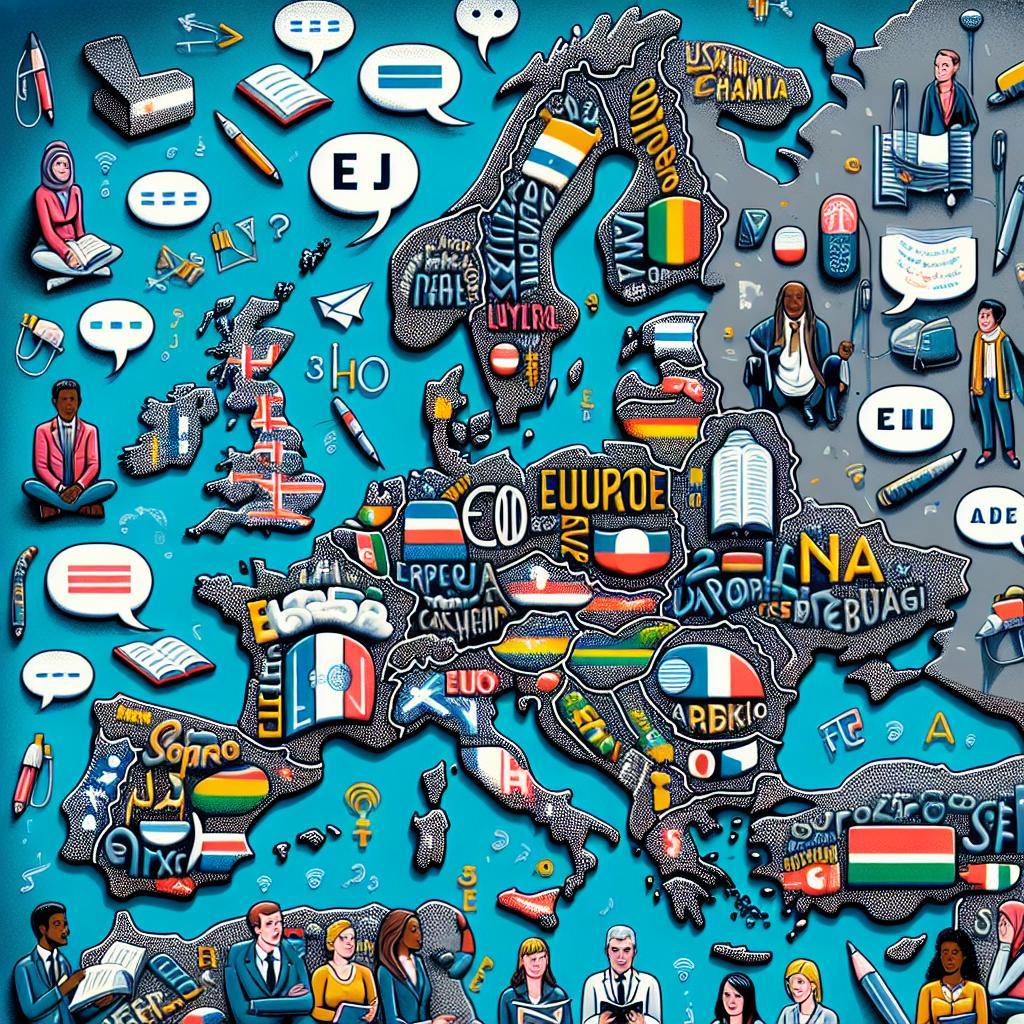EU‑Sprachenprojekte bündeln Programme wie Erasmus+, Creative Europe und CERV, um Mehrsprachigkeit, Minderheitensprachen und sprachliche Bildung zu stärken. Gefördert werden Schulpartnerschaften, digitale Lernressourcen, Übersetzungsdienste und Lehrkräftefortbildung. Ziele sind Inklusion, Mobilität, kulturelle Teilhabe und ein fairer Zugang zum Arbeitsmarkt.