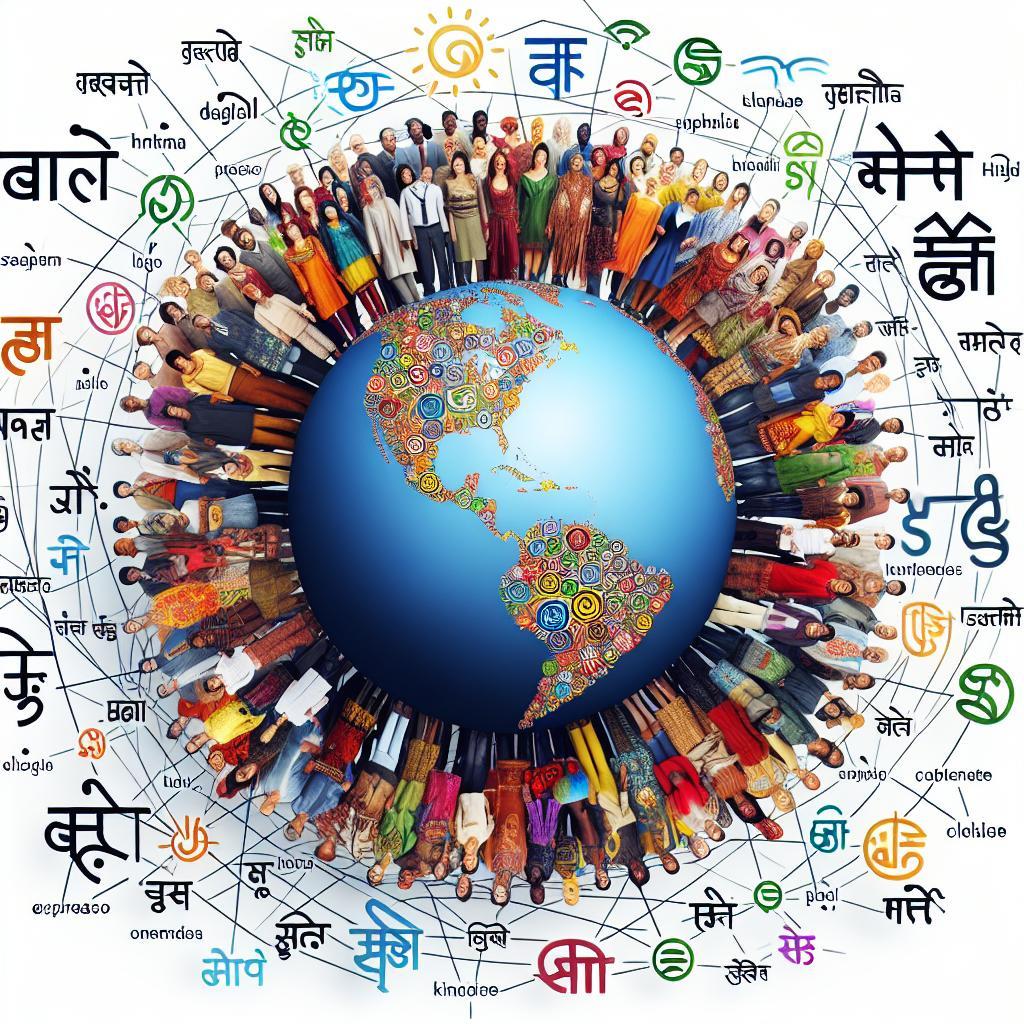Sprache fungiert als Träger von Werten, Erinnerungen und Weltbildern und verankert kollektive Identität im Alltag. Dialekte, Redewendungen und Erzähltraditionen kodieren Normen, Geschichte und Zugehörigkeit. Sprachwandel und -verlust verändern kulturelle Kontinuitäten, während Mehrsprachigkeit hybride Identitäten fördert und soziale Räume neu ordnet.