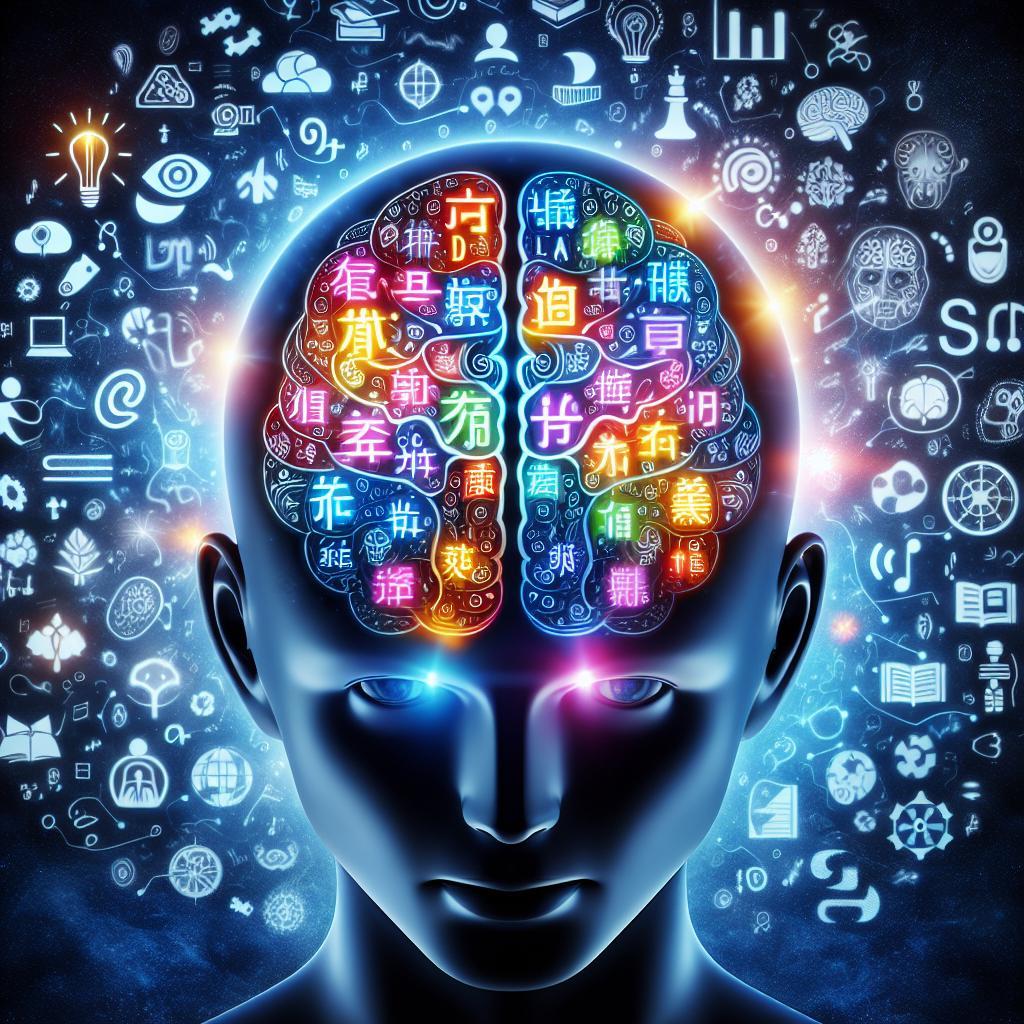Mehrsprachigkeit fördert exekutive Funktionen, Aufmerksamkeit und kognitive Flexibilität. Das Umschalten zwischen Sprachen trainiert Arbeitsgedächtnis und Inhibitionskontrolle, stärkt metalinguistisches Bewusstsein und unterstützt neuroplastische Prozesse. Studien zeigen zudem langsamere kognitive Alterung und effizientere Problemlösung in komplexen Aufgaben.