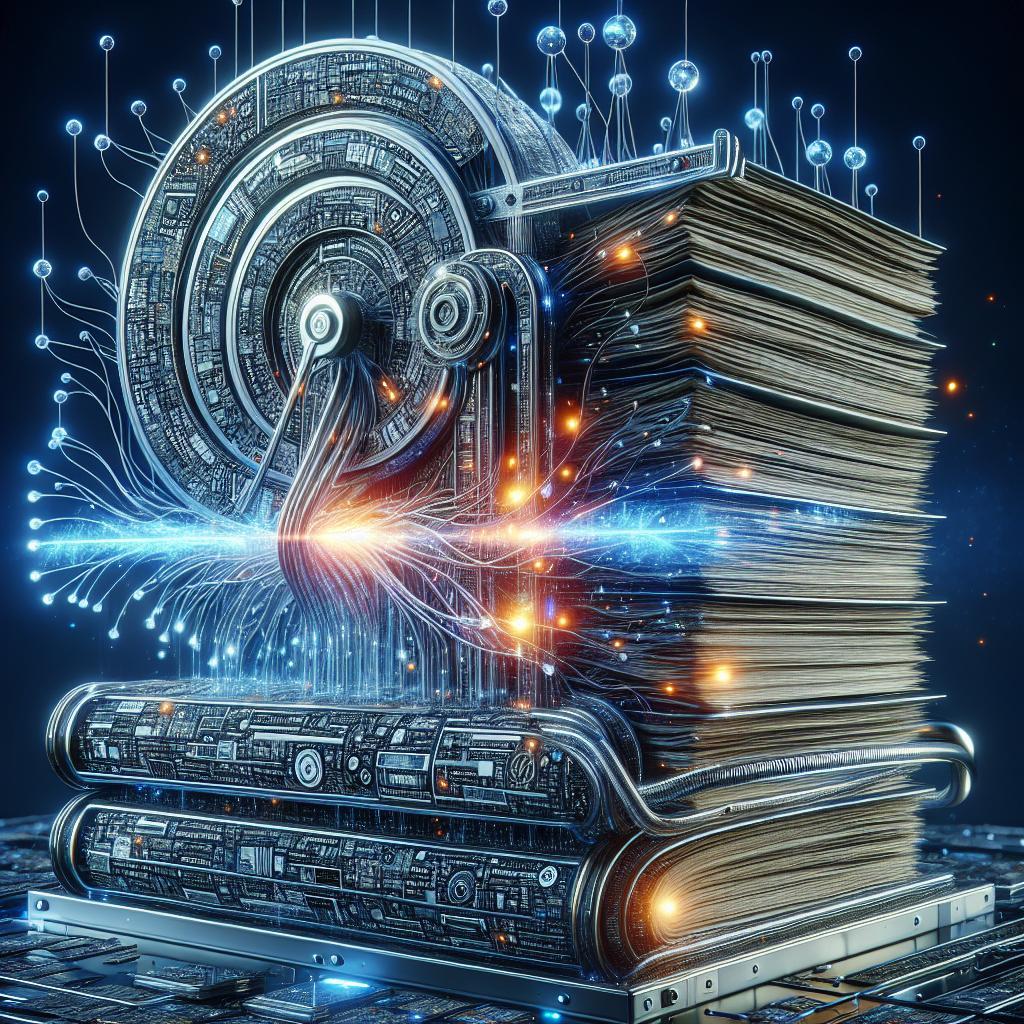Im Praxistest zeigen neuronale Übersetzungsmodelle starke Leistungen bei Alltags- und Techniksprache, mit stabiler Syntax und natürlicher Wortwahl. Unterschiede treten bei Fachterminologie, seltenen Sprachpaaren und idiomatischen Ausdrücken auf. Latenz, Kosten und Datenschutz variieren je nach Architektur. Feinabstimmung und Terminologie-Glossare verbessern Konsistenz, erfordern kuratierten Input.